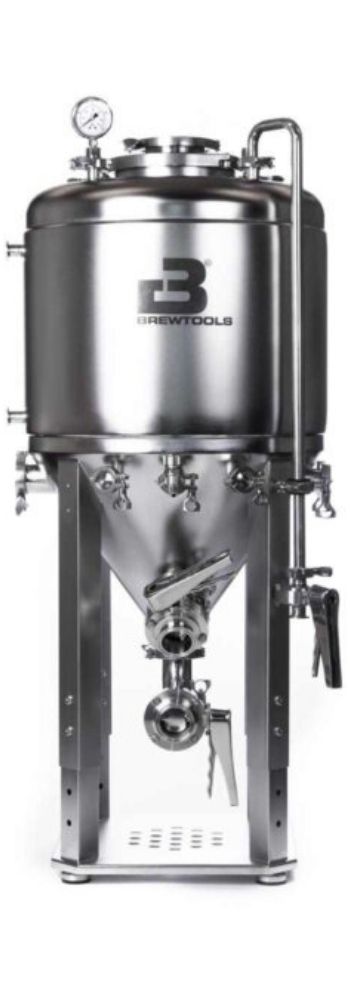Bier gehört zu Österreich wie das Wirtshaus zur Dorfmitte. Ob beim Heurigen, nach dem Wandern oder beim Grillen im Garten – kaum ein Getränk ist so fest im Alltag verankert. Aber hinter dem vertrauten „Ein Bier, bitte“ steckt oft mehr Routine als Neugier.
Zwar vereint Österreichs Brauszene große Namen und kleine Betriebe, doch zwischen alten Rezepten und neuen Ideen tut sich oft eine Lücke auf. Klassiker wie Märzen und Wiener Lager dominieren weiterhin die Getränkekarten; modernere, spannende Stile – Pils, Weizen, IPAs und Co. – tauchen im Alltag immer noch selten auf. Für ein Land, das tief in der Biertradition verwurzelt ist, ist das bemerkenswert.
Deswegen stellen wir uns die Frage: Bier – Verbreitet, vertraut, allgegenwärtig – aber wie kultiviert ist unser Umgang damit wirklich?
Ist Österreich ein Bierland?
Die Zahlen sprechen für sich: Pro Kopf werden hierzulande rund 100 Liter Bier im Jahr getrunken. Trotz langfristig rückläufigem Konsum liegt Österreich damit weiterhin an Platz zwei weltweit – nur Tschechien liegt davor. Gleichzeitig ist Österreich auch ein Weinland: Mit etwa 25 Litern Wein pro Kopf zählt es zu den Top 5 im internationalen Vergleich – sogar vor Spanien.
Beides zeigt: Bier und Wein haben hier ihren festen Platz. Historisch war Wein vielerorts das bevorzugte Genussmittel; in klassischen Weinbauregionen tat sich Bier lange schwer. Heute prägen Gewohnheiten das Bild: Wer „ein Bier“ bestellt, bekommt meist Märzen.
Gibt es eine eigene österreichische Biertradition?

Die Frage nach originär österreichischen Bierstilen lässt sich gar nicht so einfach beantwortem. Mit den Nachbarn Deutschland und Tschechien (ehemals Kronland Böhmen) gab es früh einen intensiven Austausch: Rezepte, Fachpersonal und Brautechnologien wanderten über die Grenzen und beeinflussten sich gegenseitig.
Bekannt ist etwa, dass 1842 der bayerische Braumeister Joseph Groll im damals böhmischen Pilsen (Lesetipp: Der Bierstil Böhmisches Pils) das erste Pilsner braute.
Und Anton Dreher reiste gemeinsam mit dem Münchner Gabriel Sedlmayr nach Großbritannien, bevor beide in ihrer Heimat neue Malz- und Gärverfahren einführten.Dass sich eigene Stile in Österreich dennoch entwickeln und durchsetzen konnten, hatte mehrere Gründe:
- Erstens kam nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie der Import von Bieren und Rohstoffen aus Böhmen und Ungarn abrupt zum Erliegen – heimische Brauereien mussten umdenken.
- Zweitens boten österreichische Lebensmittelvorschriften mehr Spielraum als etwa das deutsche Reinheitsgebot; Lagerbiere sind hier nicht strikt auf 100 % Gerstenmalz beschränkt.
- Drittens prägte die biersteuerliche Einteilung nach Stammwürze eigene Kategorien – und damit auch Stilentwicklungen. Denn der Staat wusste schon früh, wie man aus dem Bierdurst der Bevölkerung Kapital schlägt.
Viel Bier = große Vielfalt?
Zwar wird in Österreich überdurchschnittlich viel Bier getrunken, und auch die Anzahl der Braustätten kann sich im internationalen Vergleich sehen lassen – bezogen auf die Einwohnerzahl liegt Österreich bei der Brauereidichte sogar vor Deutschland oder Belgien.

Trotzdem täuscht diese Zahl über die tatsächliche Vielfalt hinweg:
Mehr als die Hälfte des konsumierten Bieres stammt von Marken der Brau Union, einem Tochterunternehmen des Heineken-Konzerns. Damit dominiert ein einzelner Player den Markt – sowohl was Verfügbarkeit als auch Sichtbarkeit betrifft. Der Verein unabhängiger Privatbrauereien Österreichs versucht diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Doch in Supermarktregalen und auf Getränkekarten bleibt die Auswahl oft eingeschränkt.
Auch stilistisch zeigt sich ein klares Bild: Die Nachfrage konzentriert sich stark auf untergärige, helle Lagerbiere. Das zeigt sich auch im Alltag: Wer einfach „Ein Bier, bitte“ bestellt, bekommt in der Regel ein Märzen – ohne Rückfrage, ohne Auswahl. Eine Situation, die man sich im Bereich Wein oder Kaffee kaum vorstellen könnte. Dort gehört eine gewisse Differenzierung zum Standard – beim Bier hingegen ist sie nach wie vor die Ausnahme.
Klassifizierung nach Stammwürze
Lange Zeit war es nicht die Vielfalt der Geschmäcker, die zur Kategorisierung von Bier führte, sondern ganz pragmatische Gründe – allen voran der Staat. Die Biersteuer orientiert sich bis heute an der Stammwürze und damit indirekt am Alkoholgehalt. Aktuell liegt sie bei zwei Euro pro Grad Stammwürze und Hektoliter. Ein Rechenbeispiel: Für 100 Liter eines Biers mit 12° P Stammwürze werden 24 € Biersteuer fällig. In Summe macht das für alle Brauereien in Österreich etwa 200 Millionen Euro jährlich.
Die steuerliche Einteilung unterscheidet:
- Leichtbier: unter 9° P / unter 3,7 % Vol.
- Schankbier: 9–11° P / 3,7–4,5 % Vol.
- Vollbier: 11–16° P / 4,5–7 % Vol.
- Starkbier: über 16° P / über 7 % Vol.
Für Konsument*innen sind diese Begriffe allerdings wenig hilfreich. „Schankbier“ suggeriert Ausschankfähigkeit – was faktisch für jedes Bier gilt. Und die Stammwürze allein sagt nichts über den Stil oder Geschmack aus. Ein Bier mit 12° P kann hell oder dunkel, mild oder herb, malzig oder hopfig sein.
Moderne Bierstilanalyse orientiert sich daher an mehreren Parametern: Farbe, Aroma, Bittere, Gärungstyp und Alkoholgehalt.
Die wichtigsten österreichischen Bierstile im Überblick
Österreichisches Märzen – Was ist das eigentlich?

Rund zwei Drittel des in Österreich verkauften und servierten Biers läuft unter „Märzen“. Eine Besonderheit des Markts: Streng genommen ist das, was hierzulande als Märzen gilt, kein „echtes“ Märzen – man spricht deshalb vom „Märzen österreichischer Brauart“. Anders als das international bekannte Märzen ist das alpenländische Märzen ein helles Bier mit ca. 5 % Alkohol. Die Rezeptur ist hopfenwürziger als ein Helles und liegt stilistisch nahe am Dortmunder Export.
Die erste Erwähnung in Österreich stammt 1732. Der Name verweist auf den März, als man zum Ende des Winters ein für damalige Verhältnisse kräftiges, lagerfähiges Bier braute, das den Sommer im Keller überdauerte.
In Deutschland und Österreich entwickelte sich der Stil anschließend unterschiedlich: Hier entstand ein beliebtes, süffiges, goldenes Bier – dank der Einführung heller Malze. Mancherorts wird es daher schlicht „Gold“ genannt.
Wiener Lager – weltweit bekannt
Inzwischen ist das Wiener Lager in Österreich wieder weit verbreitet. Es brauchte jedoch u. a. den Einsatz der US-Craftbeer-Szene, um diesen hier fast vergessenen Stil neu zu beleben. Natürlich haben wir als Lokalpatrioten dem Wiener Lager und seiner Geschichte einen eigenen Blog-Artikel gewidmet: 👉 Mehr zum Stil im eigenen Blogbeitrag: Der Bierstil Wiener Lager
Spezial – eine geschätzte Randerscheinung
Je nach Region ist ein „Spezial“ heute auf Getränkekarten selten; rund 4 % Marktanteil sind diesem einst beliebten Stil geblieben. Es schließt die Lücke zwischen Märzen und Bockbier: kräftiger eingebraut (mind. 12,5 °P, typischerweise bis 14 °P), farblich zwischen sattem Gold und hellem Bernstein. Geschmacklich – ähnlich dem Märzen – liegt der Fokus auf Ausgewogenheit zwischen Malzkörper und Hopfenwürze, oft mit einem kleinen Anteil heller Karamellmalze.
Österreichisches Dunkles – hier gibt es viel aufzuholen
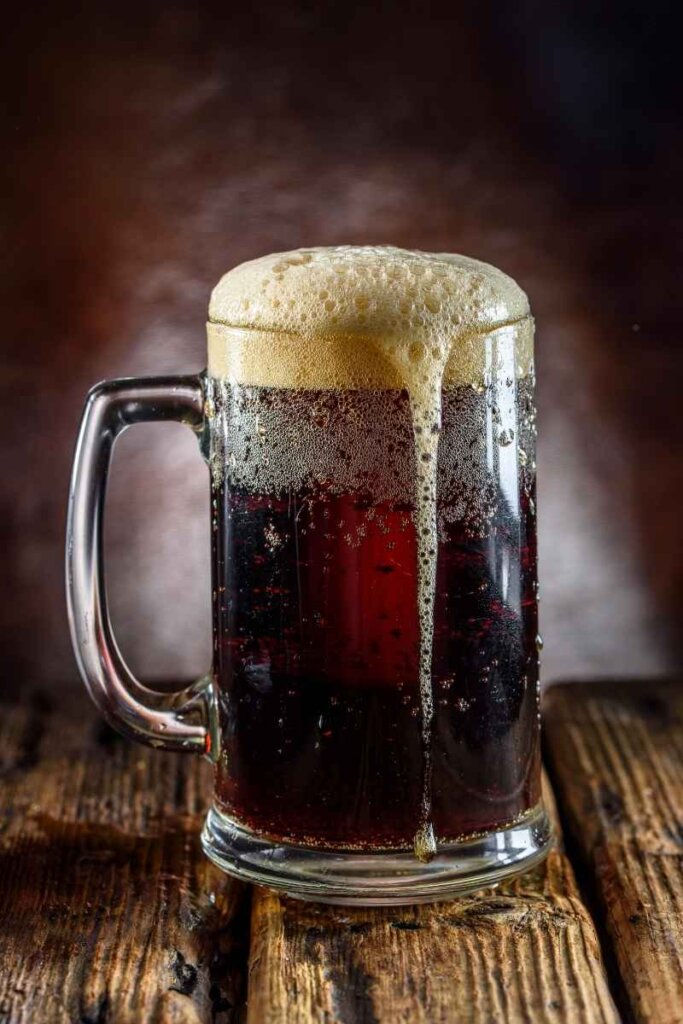
Dunkle Biere haben in Österreich einen schweren Stand und sind mit einigen Vorurteilen behaftet. Das klassische österreichische Dunkle ist häufig süß mit spürbarem Restextrakt; Bezeichnungen wie „Doppelmalz“ deuten auf viel Körper hin.
Ein bekannter Vertreter hat etwa 3,4 % Alkohol – der unvergorene Zucker bleibt also im Bier. Entsprechend wird das Dunkle im Stammtischdunst hämisch als „Frauen-“ oder „Kinderbier“.
Gleichzeitig gibt es eine erfreuliche Gegenbewegung: Das insgesamt bestbewertete Bier der Staatsmeisterschaft 2024 (www.austrianbeerchallenge.at) war ein Dunkles – modern interpretiert und qualitativ top.
Leichtbiere – historisch gewachsen, modern interpretiert
Leichte Biere mit wenig Alkohol (unter 3 % Vol.) gibt es seit Jahrhunderten. Sie galten früher sogar als Grundnahrungsmittel, besonders in Zeiten schlechter Wasserqualität. In den 1980er-Jahren erlebten sie durch den Fitness-Boom ein kurzes Comeback – unter Namen wie Sportbier oder Fitnessbier. Heute feiern sie ihr Revival: Alkoholarme Biere und hopfenbetonte Session IPAs boomen – nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch wegen ihrer geschmacklichen Vielfalt.
Was sonst noch so getrunken wird
Pils, in Deutschland die meistverkaufte Sorte, macht in Österreich nur etwa 3 % des Bierumsatzes aus. Allzu herbe Biere haben hier weniger Fans, auch wenn einzelne Brauereien sich auf den Stil spezialisiert haben. Insgesamt ähnelt das österreichische Pils dem deutschen, verwendet aber häufig Mühlviertler Hopfen. Noch niedriger liegt der Anteil beim Weizenbier – etwa 1 %. Viele Brauereien führen ein klassisches Weißbier, doch die Zahlen zeigen: In Österreich bleibt es eine außerordentliche Spezialität.
Zusammenfassung
Österreich bleibt ein Land der hellen, süffigen, untergärigen Biere – Vielfalt und Neugier wachsen langsam. Obergärige und dunkle Stile sind zwar noch Nische, gleichzeitig boomen leichtere und alkoholfreie Varianten. Vor allem kleinere und mittlere Brauereien treiben mit „Qualität statt Quantität“ die Bierkultur voran. Und das Schöne: Märzen und Wiener Lager behaupten sich weiterhin stark, während der Export österreichischer Biere weiter zulegt.
Wenn du jetzt Lust auf mehr bekommen hast: Stöbere in unseren Rezepten, Guides und Zutaten – und brau dir ein Glas österreichische Bierkultur. Prost!