Advanced, Brautechniken, Fortgeschritten
Maischverfahren im Vergleich – von der Kombirast bis zur Dekoktion
Ob dein selbstgebrautes Bier am Ende trocken oder süß, schlank oder vollmundig wird, hängt nicht nur von den Zutaten ab – sondern ganz wesentlich vom Maischverfahren. Die Art und Weise, wie du Temperatur und Zeit beim Maischen steuerst, entscheidet über die Zusammensetzung deiner Würze und damit über Geschmack, Körper und Vergärbarkeit.
Gerade als Hobbybrauer ist es hilfreich, die Grundlagen und Unterschiede der gängigen Maischverfahren zu kennen. In diesem Beitrag stellen wir dir die wichtigsten Maischverfahren vor – von der einfachen Kombirast über die mehrstufige Infusion bis hin zu Spezialmethoden wie der Earl’schen Kochmaische oder der traditionellen Dekoktion. Du erfährst, wie die Verfahren funktionieren, wann ihr Einsatz sinnvoll ist – und welche Wirkung sie auf dein Bier haben.
Was beim Maischen passiert – Grundlagen, Enzyme & Wirkung
Der Begriff „Maischen“ stammt vom mittelhochdeutschen mischen – und genau das beschreibt den Vorgang sehr treffend: Geschrotetes Malz wird mit warmem Wasser vermischt, um die im Malz enthaltenen Enzyme in Lösung zu bringen. Diese Enzyme – vor allem Alpha- und Beta-Amylase – spalten die im Korn gespeicherte Stärke in lösliche Zucker auf, die später von der Hefe zu Alkohol vergoren werden.

Dazu wird das Brauwasser, der sogenannte Hauptguss, zunächst auf die gewünschte Einmaischtemperatur erhitzt. Anschließend wird das geschrotete Malz eingerührt. Die daraus entstehende Maische wird anschließend schrittweise erwärmt – in sogenannten Rasten – um die enzymatische Aktivität gezielt zu steuern und die Zusammensetzung der Würze zu beeinflussen.
Für das Hobbybrauen ist das Maischen ein zentrales Werkzeug: Mit der gewählten Temperatur bestimmst du, welche Enzyme aktiv sind – und damit, wie trocken oder vollmundig dein Bier am Ende wird.
Wichtige Enzyme beim Maischen und ihre Temperaturbereiche:
- Beta-Amylase: aktiv zwischen ca. 54–66 °C, Optimum bei 62–64 °C
→ produziert leichter vergärbare Zucker (Maltose) → schlankes, trockenes Bier - Alpha-Amylase: aktiv zwischen ca. 66–75 °C, Optimum bei 70–72 °C
→ produziert schwerer vergärbar bis unvergärbare Zucker (Maltotriose) → mehr Körper, Süße
Durch die Kombination oder gezielte Auswahl dieser Temperaturbereiche kannst du den Charakter deines Bieres bereits in der Maischephase entscheidend beeinflussen.
1. Kombirast – das einfachste Maischverfahren für moderne Malze
Die Kombirast ist das einfachste Maischverfahren: Du maischst bei einer einzigen Temperatur ein – meist zwischen 66 und 72 °C – und hältst diese für etwa 60 Minuten. In diesem Bereich arbeiten sowohl die Beta-Amylase als auch die Alpha-Amylase zuverlässig. Je höher du die Kombirast-Temperatur wählst, desto mehr Restextrakt bleibt im fertigen Bier übrig.

Weil moderne Braumalze hochmodifiziert sind, reicht diese Methode in vielen Fällen völlig aus, um gute Ergebnisse zu erzielen. Die Kombirast bringt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vergärbarkeit und Restextrakt und eignet sich besonders für unkomplizierte Biere und den Einstieg ins eigene Brauen.
- Guter Kompromiss zwischen schlanken und süffigen Charakter des Biers
- Einfache Temperaturführung bei ca. 66–72 °C
- Ideal für amerikanische, britische & irische Ales
2. Mehrstufige Infusionsmaische – klassisches Maischverfahren mit präziser Temperatursteuerung
Bei der mehrstufigen Infusionsmaische wird die Temperatur schrittweise erhöht, um verschiedene Enzymrasten nacheinander zu aktivieren. Typischerweise beginnt man bei etwa 63 -65°C für 30-40 Minuten, um der Beta-Amylase optimale Bedingungen zu geben. Danach folgt eine Rast bei etwa 71–73 °C für 20-30 Minuten für die Alpha-Amylase. Am Ende wird wie bei jedem Maischeverfahren bei 78 °C abgemaischt, um die Enzymaktivität zu stoppen.

Dieses Verfahren erlaubt im Vergleich zur Kombirast eine präzisere Steuerung von Vergärbarkeit, Körper und Aroma deines Biers, weil du näher an den Temperatur-Optima der einzelnen Enzyme bist. Es eignet sich besonders für Biere mit definiertem Stilprofil wie Lagerbiere oder wenn du bestimmte Hefecharakteristiken unterstützen willst. Auch bei schwierigen Rohstoffen ist diese Methode hilfreich.
- Gut für untergärige Bierstile oder Spezialbiere
- Rastwechsel mit gezielter Temperatursteuerung
- Hohe Kontrolle über Würzezuckerprofil
3. Herrmann-Verfahren (Maltaseverfahren) – Spezial-Maischverfahren für fruchtige Weißbiere
Das Herrmann-Verfahren, auch Maltaseverfahren genannt, ist ein spezielles Maischverfahren zur Erhöhung des Glukoseanteils in der Würze – ideal für obergärige Biere wie Hefeweizen, bei denen ein fruchtiges Esterprofil erwünscht ist.
Beim klassischen Maischen besteht der Zuckeranteil zu etwa 90 % aus Maltose und nur zu 10 % aus Glukose. Die Maltase, ein temperaturempfindliches Enzym im Malz, kann jedoch gezielt aktiviert werden, um den Glukoseanteil deutlich zu steigern – auf bis zu 35–40 %.
Dazu wird zunächst etwa 60% der Schüttung und des Wassers bei 62 °C eingemaischt und 40 Minuten gerastet, anschließend auf 70 °C erhöht und 20 Minuten gerastet. Anschließend wird eine kalte Teilmaische (restliches Malz + Wasser) eingemischt, um die Gesamtmaische auf 45 °C abzukühlen. In dieser Maltaserast kann das Enzym rund 40 Minuten arbeiten, bevor wie gewohnt weitergemaischt wird.
Der höhere Glukosegehalt verändert die Gärung deutlich: Isoamylacetat (Banane) und Ethylacetat (Birne) steigen stark an, während Acetaldehyd reduziert wird. So lässt sich das fruchtige Aromaprofil von Weißbieren gezielt verstärken – rein durch Maischeführung (passend zum Ausprobieren mit dem Braurezept Lederhosen – Bayrisches Hefeweizen).

4. Dekoktion – traditionelles Maischverfahren für vollmundige Lagerbiere
Die Dekoktion ist ein traditionelles Maischverfahren, das vor allem in der tschechischen und bayerischen Braukultur tief verankert ist. Das Prinzip: Ein Teil der Maische wird entnommen, stufenweise erhitzt, gekocht und danach wieder zurückgegeben. So steigt die Temperatur der Hauptmaische – ganz ohne direkte Beheizung.
Ursprünglich als simples Maischverfahren entwickelt, liefert die Dekoktion auch heute noch vollmundige, kernige Biere mit hoher Drinkability. Bei klassischen Lagerstilen wie böhmischem Pils oder Hellem ist sie besonders verbreitet und lässt sich auch mit gängigen Heimbrauanlagen umsetzen (am besten mit dem Original 1842 – Tschechisches Pils ausprobieren).
Warum sich Dekoktion lohnt:
- Intensiver Malzcharakter durch stärkere Maillard-Reaktion
- Mehr Körper trotz hoher Vergärbarkeit
- Bessere Schaumstabilität
- Höhere Sudhausausbeute
- Ausgleich von Schwankungen im Malz
- Authentischer Geschmack bei traditionellen Lagerbieren
Dekoktionsarten im Überblick

✅Einfache Dekoktion:
Nur eine Teilmaische wird gekocht (z. B. von 63 °C auf 72 °C)
Ablauf:
- Einmaischen bei 63 °C, 30 Min. Rast
- 1/3 Maische entnehmen
- Teilmaische: 65 °C für 15min, 75 °C für 15min, 100°C für 20min
- Rückführen der Teilmaische zur Hauptmaische→ Hauptmaische erreicht 72 °C
- Rast 20–30 Min. bei 72 °C und danach abmaischen
✅Doppelte Dekoktion
Beim Verfahren der doppelten Dekoktion wird zunächst bei 50 °C eingemaischt. Etwa ein Drittel der Maische wird entnommen, separat erhitzt und anschließend gekocht. Nach dem Rückführen steigt die Hauptmaische auf rund 63 °C. Dieser Vorgang wird bei 63°C ein zweites Mal wiederholt, wodurch die Hauptmaische schließlich etwa 72 bis 74 °C erreicht. Das Prinzip bleibt gleich – nur dass der Ablauf zweimal hintereinander erfolgt. Zum Abschluss erfolgt das Abmaischen bei 78 °C, danach wird wie gewohnt geläutert und gekocht.
Vorteil: höhere Komplexität, mehr Karamellisierung.
Nachteil: spürbar mehr Aufwand.
✅ Dreifache Dekoktion (klassisch bei Pilsner Urquell)
DIE traditionelle Methode für böhmisches Pils. Wird meist in Kupferkesseln direkt erhitzt, aber auch im Hobbymaßstab machbar. Beim klassischen Verfahren der dreifachen Dekoktion, angepasst für Heimbrauer, wird zunächst bei 38 °C eingemaischt und eine 15-minütige Rast gehalten. Dann folgt die erste Dekoktion: Etwa ein Drittel der Maische wird entnommen, durchläuft die bereits oben beschriebene Abfolge an Raststufen und wird anschließend gekocht. Nach dem Rückführen erreicht die Hauptmaische ca. 50 °C. Die zweite und dritte Dekoktion folgen demselben Prinzip: jeweils ein Drittel der Maische wird entnommen, wie zuvor behandelt und rückgeführt. So steigt die Temperatur der Hauptmaische schrittweise auf etwa 63 °C bzw. 72 °C an. Zum Abschluss erfolgt das Abmaischen bei 78 °C, danach wird wie gewohnt geläutert und gekocht.
Gesamtdauer: ca. 3,5 bis 4 Stunden
Typische Biere: böhmisches Pils, Wiener Lager, Tmavé, Polotmavé, Export-Helles
5. Earl’sche Kochmaische – modernes Maischverfahren mit Dekoktionscharakter
Die von Heimbrauer Earl Scheid entwickelte Methode bringt das typische Dekoktionsaroma ins Bier – ohne dass du mehrfach Maische abziehen, separat rasten und kochen musst. Ideal für alle, die mehr Tiefe im Lagerbier wollen, aber keinen vierstündigen Maischeplan durchziehen möchten.
Trotz etwas zusätzlichem Aufwand beim Einmaischen und Aufkochen lohnt sich der Einsatz: Das Verfahren sorgt für einen kernigen, getreidigen Geschmack, verbessert die Schaumstabilität, steigert die Sudhausausbeute – und mit optionaler Grenzdextrinase-Rast erreichst du sogar einen höheren Vergärungsgrad.

Ablauf der Earl’schen Kochmaische:
Zunächst wird etwa 80 % der Schüttung mit der dreifachen Wassermenge eingemaischt – zum Beispiel 4 kg Malz mit 12 l Wasser. Die restlichen 20 % des Malzes werden beiseitegestellt.
Es wird ganz normal gerastet, entweder mit einer Kombirast bei etwa 67 °C oder einem stufenweisen Maischprogramm, je nach gewünschtem Bierstil.
Nach Ende der Rasten wird nicht abgeläutert, sondern die Maische direkt im selben Gefäß für etwa 10 bis 15 Minuten gekocht. Dabei entstehen kräftige Farb- und Aromastoffe, alle Enzyme werden durch das Kochen vollständig inaktiviert – was hier bewusst gewollt ist.
Anschließend wird die gekochte Maische mit dem restlichen Malz und dem restlichen, möglichst kalten Brauwasser vermischt. Dadurch sinkt die Temperatur – ideal auf ca. 60 °C, wenn eine optionale Grenzdextrinase-Rast eingebaut werden soll, um den Vergärungsgrad zu erhöhen. Danach kann ein reguläres Maischprogramm durchgeführt werden, etwa eine Kombirast oder ein klassisches Zweistufenverfahren mit Rasten bei 63 °C und 72 °C. Nach Abschluss der Hauptmaische folgen Läutern und Würzekochen wie gewohnt.
Wenn du also schon immer mal „Dekoktion light“ probieren wolltest: Die Earl’sche Kochmaische ist der einfachste Einstieg.
Fazit: Mit dem richtigen Maischverfahren zum perfekten Bier
Mit der Wahl des richtigen Maischverfahrens legst du den Grundstein für Geschmack, Körper und Charakter deines Bieres. Ob einfache Kombirast, präzise Infusionsmaische oder aufwendige Dekoktion – jedes Verfahren hat seine Stärken und beeinflusst die Zusammensetzung deiner Würze entscheidend. Auch Spezialmethoden wie das Herrmann-Verfahren oder die Earl’sche Kochmaische eröffnen neue Möglichkeiten, das Aromaprofil gezielt zu steuern. Wenn du deine Biere weiterentwickeln willst, lohnt sich der Blick über den Tellerrand: Schon kleine Anpassungen im Maischeplan können große Wirkung im Glas zeigen.




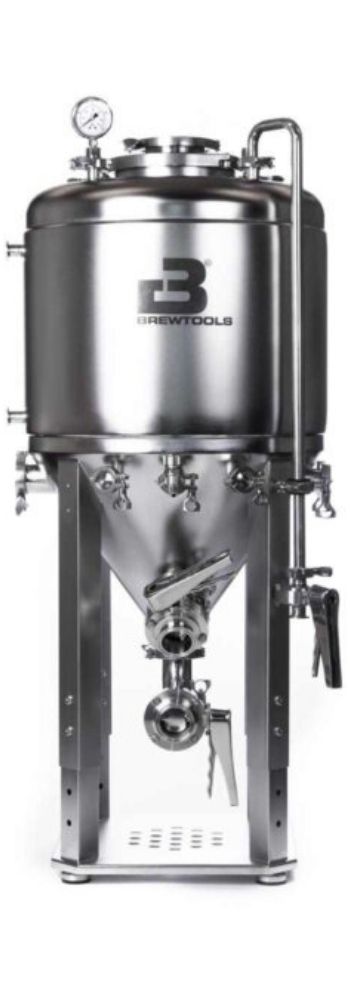




Hallo! Habe eine Frage zur “ Earl’schen“ Dekoktion.
Kann ich mit dem Grainfather G 70 V2 mit eingesetzten
Malzrohr auf 100 Grad gehen?
Hält das die Pumpe aus?
Habe bisher immer Maische entnommen und seperat auf einer
Kochplatte gekocht,wenn Dekoktion notwendig war.
Mfg.Dresch Josef
Servus Josef,
die Pumpe deiner Brauanlage schaltest du im letzten Maischeschritt (z.B bei 72°C) aus. Wenn alles kocht, benötigst du keine Umwälzung. Bitte vorsichtig sein mit Kochmaischen in Malzrohranlagen, es muss immer genug Flüssigkeit vorhanden sein, um ein Anbrennen der Heizplatte zu verhindern. Empfohlene Temperatureinstellung beim Kochen der Maische: 99°C.
Liebe Grüße
Klaus
Hallo, ich hab eine Frage zum Herrmann-Verfahren, kann ich beim Weizenrezept (Lederhosn) einfach Hauptgusswasser bzw. Malzmenge * 0,75 rechnen und den Rest zu einer kalten Teilmaische verrühren und dann nach den 20 Minuten bei 70 ° einfach beimengen? Oder gibt es bzgl. Mengen eine genauere Berechnung?
Es steht auch am Schluss:“… bevor wie gewohnt weitergemaischt wird.“ D.h. ich fahre dann mit der Gesamtmenge nochmal alle Rasten laut Rezept?
Danke für eure Hilfe
Hallo,
wenn dein Wasser ca. 10°C hat, dass du beimengst, um die Würze von 70°C auf 45°C zu kühlen, musst du ca. 40% des Wassers & Malz vom Hauptguss zurückhalten. Berechnen kannst du so etwas über die Mischkreuz-Berechnung bei unseren Brauberechnungen. Variablen, die du dort einsetzen musst:
Konzentration#1: 70 (°C) = Maischetemperatur
Konzentration#2 :10 (°C) = Temperatur des zugeführten Kaltwassers vom Hauptguss
Ziel Mischverhältnis / Konzentration: 45 (°C) = gewünschte Maischtemperatur nach dem Vermengen
Benötigtes Gesamtvolumen: 19 (L) = der komplette Hauptguss
Nach der Rast bei 45°C für ca. 20-30min wird normal weitergemaischt, 35min bei 63°C & 20min bei 72°C.
LG Klaus